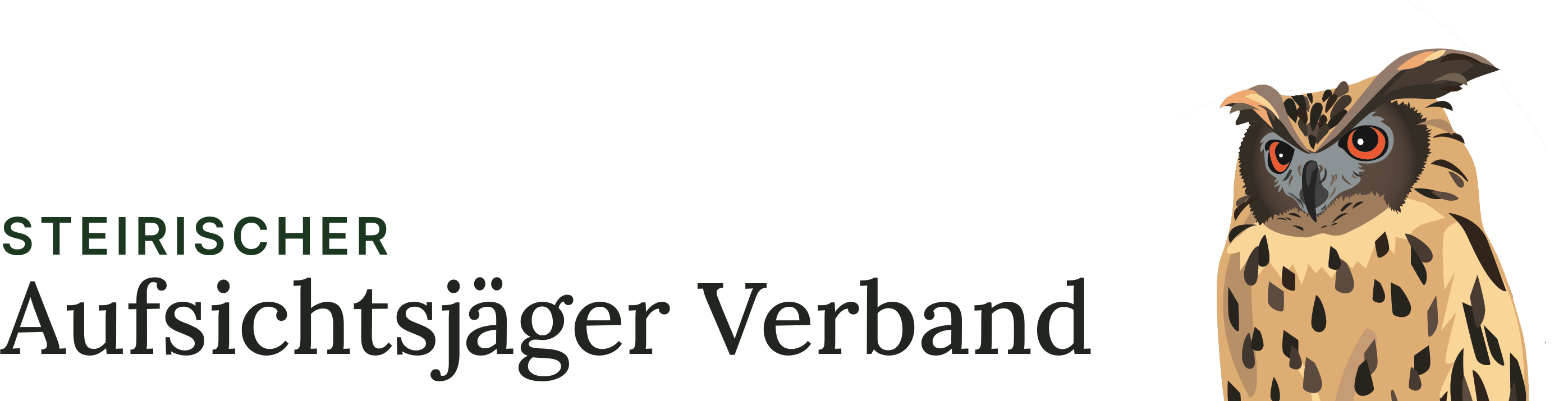Virus höchst ansteckend für Paarhufer – Gefahr für Menschen nicht gegeben – Sporadische Ausbrüche in Europa – Afrika, Asien und Südamerika dagegen stärker betroffen
Wien (APA) – Das Maul-und-Klauenseuche-Virus gefährdet Rinder, Schweine, Ziegen, Schafe und Rehe. Es gilt als höchst ansteckend für Paarhufer, betroffene Tiere müssen getötet werden. Menschen erkranken nicht daran, ebenso wenig Hunde und Katzen. Hierzulande gab es 1981 und 1952 kleine Ausbrüche und eine große Bredouille mit der Maul und Klauenseuche anno 1973. In jüngster Zeit waren alle Verdachtsfälle in Österreich negativ.
Potenzielle Wirte des Virus
Das Maul-und-Klauenseuche-Virus infiziert Rinder und Schweine, Ziegen, Schafe und Rehe. Auch Büffel, Elefanten, Kamele, Giraffen und Alpakas gehören zu seinen Opfern. Pferde sind dagegen immun. Für Menschen ist es ungefährlich. Bei intensivem Kontakt mit erkrankten Tieren tritt zwar gelegentlich eine Infektion auf, sie führt aber in der Regel nicht zu einer Erkrankung, so die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Hunde und Katzen erkranken auch nicht an Maul-und-Klauenseuche (MKS). Sie können laut den Experten jedoch mit dem Virus kontaminiert sein und es somit indirekt weiterverbreiten.
Entdeckung
Das Virus wurde 1898 von den zwei deutschen Bakteriologen Friedrich Loeffler und Paul Frosch nachgewiesen, die sich mit der Entdeckung zu den ersten Virologen mauserten. Es hat so wie SARS-CoV-2 als Erbgut RNA. Das Maul-und-Klauenseuche-Virus vermehrt sich in den Wirtszellen, woraufhin es deren Hüllwände zerstört und neue „Virionen“ freigesetzt werden. Sie sind dermaßen infektiös, dass wohl ein einzelnes davon für die Ansteckung eines Tieres genügt.
Vorkommen
In Afrika, Asien und Teilen Südamerikas gibt es fortwährend Krankheitsfälle, dort ist die Maul- und Klauenseuche demnach „endemisch“. In Europa treten nur sporadische Ausbrüche wie aktuell auf. Das war etwa in Großbritannien 2007 und 2001/2002 der Fall. Neuseeland blieb bisher als einzige Region in der Welt (wo es Rinder, Schweine und andere potenzielle Opfer gibt) von dem Virus verschont.
Übertragung
Das Maul-und-Klauenseuche-Virus wird meist durch Kontakt- oder Schmierinfektionen direkt von einem Tier auf andere übertragen. Diese können sich aber auch in kontaminierten Pferchen und Viehtransportwagen anstecken. Menschen verschleppen das Virus etwa in der Kleidung und an den Schuhen von einem Stall zum anderen. Sogar eine Übertragung über die Luft ist beträchtliche Distanzen (bis zu 60 km) möglich, heißt es vonseiten der AGES.
Das Krankheitsbild
Die erkrankten Tiere (aller betroffenen Arten) bekommen bei einer Infektion Blasen am Maul, Euter und an den Klauen. Sie haben über 40 Grad Celsius Fieber, Schmerzen, wollen sich kaum bewegen, sind apathisch und appetitlos. Muttertiere geben zudem weniger Milch als zuvor.
Keine Impfung
Eine prophylaktische Impfung ist laut AGES in der EU verboten. Laut Europäischer Kommission ist die Impfung „in der EU 1991 eingestellt worden, weil die MKS mit Erfolg getilgt worden war“. Damit habe man Geld eingespart „und es wurde Gemeinschaftserzeugern ermöglicht, in Länder zu exportieren, die nur Einfuhren aus MKS-freien Ländern zulassen, die keinerlei Impfpolitik betreiben.“
Vorbeugung und keine Therapie
Die gängige Vorbeugung ist eine Verhinderung der Übertragung von Tier zu Tier. Landwirte sollten etwa beim Betreten des Stalles eigene Kleidung und Stiefel tragen, sowie davor und danach die Hände desinfizieren. Fremde Stallbesuche sind in Seuchenzeiten zu vermeiden. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeit für erkrankte Tiere. Tritt in einem Betrieb Maul- und Klauenseuche auf, müssen dort laut Gesetz alle Klauentiere „gekeult“ (zwecks Eindämmung der Seuche getötet) werden.
Diagnostik
Die Maul-und-Klauenseuche kann selbst von Experten anhand des Krankheitsbildes nicht sicher von anderen Erkrankungen unterschieden werden. Sie wird deshalb durch Laboruntersuchungen erkannt oder ausgeschlossen. Das kann beispielsweise durch PCR-Tests von Probematerial des Tieres sein, oder mittels Antigen-Tests. Schon beim Verdacht auf die meldepflichtige Tierseuche müssen Amtstierärzte eine sofortige Betriebssperre und Untersuchung der Tiere einleiten.
Maßnahmen bei positiven Tests
Die Behörde sperrt den betroffenen Betrieb, alle empfänglichen Tiere dort werden gekeult. Die Kadaver werden umgehend beseitigt, alles wird desinfiziert. Eine Schutzzone von mindestens drei Kilometern um den „Seuchenbetrieb“ wird eingerichtet, sowie eine Überwachungszone von mindestens zehn Kilometern Umkreis.
Ausbrüche in Österreich
Der bisher letzte Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Österreich geschah im Jahr 1981. Es waren aber nur einzelne Tiere in Niederösterreich betroffen. Die Verbreitung wurde rasch gestoppt. Dramatisch war die Situation jedoch 1973. Über Monate hinweg grassierte die Seuche damals in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland. Über 1.600 Gehöfte waren betroffen, etwa 4.500 Rinder, über 75.000 Schweine, 245 Ziegen, 25 Schafe und ein Lama wurden gekeult. Rund um die Ortschaften wurden „Seuchenteppiche“ mit Desinfektionsmittel ausgelegt, die man überschreiten und -fahren musste, um die Viren nicht weiter zu verschleppen. Belegt ist außerdem ein Ausbruch im September 1952 in Fischamend (damals ein Teil von Groß-Wien, heute in Niederösterreich). Es waren aber nur Rinder aus acht Höfen betroffen, und die Situation wurde rasch unter Kontrolle gebracht.
Ausschlussuntersuchungen
Die AGES nimmt regelmäßig bei Verdachtsfällen sogenannte Ausschlussuntersuchungen durch. Das passiert jedes Jahr nur bei wenigen Nutztieren, zum Beispiel zwei im Jahr 2023, sechs anno 2022 und keinem im Jahr davor. Zusätzlich werden jährlich eine Handvoll Zootiere getestet. Weder bei Nutz- noch Zootieren gab es in den vergangenen paar Jahren positive Fälle.